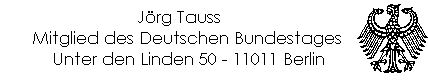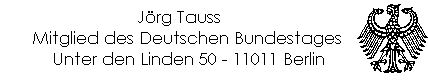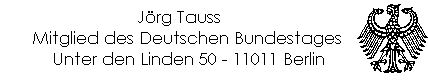
Szenario 2010 - Verlage, Buchhandlungen und Bibliotheken in der Informationsgesellschaft
Anmerkungen aus der Perspektive der Politik
Beitrag zum Symposium "Wissenschaftspublizistik im digitalen Zeitalter - eine Standortbestimmung" Berlin, 08. und 09. Februar 2001
Jörg Tauss, MdB
Bildungs- und forschungspolitischer Sprecher und Beauftragter für Neue Medien der SPD-Bundestagsfraktion; Vorsitzender des Unterausschusses Neue Medien beim Bundestagsausschuss für Kultur und Medien, Ordentliches Mitglied im Ausschuß für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung und im Ausschuss für Kultur und Medien, stv. Mitgleid im Innenausschuss des Deutschen Bundestages.
E-Mail: joerg@tauss.de oder joerg.tauss@bundestag.de.
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
sie haben mich als Politiker zu Ihrem Symposium "Wissenschaftspublizistik im digitalen Zeitalter - eine Standortbestimmung" eingeladen, ein Eingangsstatement zum Thema "Szenario 2010 - Verlage, Buchhandlungen und Bibliotheken in der Informationsgesellschaft" zu machen. Zugegeben - angesichts der technologischen Dynamik und angesichts der damit einhergehenden gravierenden Gesellschaftsumbrüche erscheint es mit etwas gewagt, Prognosen oder Szenarien für das Jahr 2010 zu entwerfen.
Dazu mag vielleicht ein Verweis auf die Folgen des Buchdrucks hilfreich sein. Vor ein paar Jahren konnte man im SPIEGEL ein Gespräch nachlesen, das auf der Frankfurter Buchmesse zwischen Johannes Gutenberg, dem Pionier der Buchdruckerkunst, und Bill Gates, dem Begründer von Microsoft, stattgefunden haben soll und welches dankenswerter Weise von John Updike aufgezeichnet wurde. In diesem Gespräch sagt Gates, schon etwas gereizt infolge dieses Disputs über hoffnungslos veraltete Technologien, zu Gutenberg: "Ihre Zeit ist um, alter Freund, Ihre fünf Jahrhunderte, um genauer zu sein, und jetzt werden Ihre schwerfälligen, verstaubenden, ganze Wälder vernichtenden Drucksachen weggepackt. Die Buchmesse unter uns ist in Wahrheit eine Totenfeier, genau wie, in den Worten Ihres großen Philosophen Nietzsche, Kirchen in Wahrheit die Gräber, die Grabdenkmale Gottes sind."
Und Gutenberg antwortet folgendes: "Vielleicht ist das Buch, wie Gott, eine Idee, an der einige Menschen festhalten werden. Die Revolution des Buchdrucks hat einen natürlichen Verlauf genommen. Wie ein Fluß ist das gedruckte Wort zu seinem Leser geflossen, und die billigen Mittel seiner Verbreitung haben es ihm erlaubt zu tröpfeln, wo der Kanal zu eng war. Die elektronische Flut, die Ihr beschreibt, kennt keine Ufer. Sie überschwemmt alles, aber womit und für wen? Ihre Inhalte wirken so klein, gemessen am Genius ihrer Technologie."(1)
Heute - 500 Jahre nach der Erfindung des Buchdrucks kann man im Nachhinein - und die Wissenschaft der Kommunikation beschäftigt sich zunehmend auch mit solchen Fragestellungen - die tatsächlichen revolutionären Folgen der Erfindung des Buchdrucks im Jahre 1455 als erstes Massenmedium beschreiben, die damals vermutlich so niemand erahnt oder auch befürchtet hat. Die Loslösung aus der geistigen Vorherrschaft und dem Weltentwurf-Interpretationsmonopol der Theologie, die Ausbildung der Wissenschaften, das Entstehen von Zeitungen und dem Prinzip Öffentlichkeit, die Entwicklung demokratischer Prinzipien, die Entwicklung einer einheitlichen Hochsprache, die Schulpflicht, die Liste ließe sich beliebig verlängern - all das sind die unvorhergesehenen Folgen des Buchdrucks, all das wäre ohne die Möglichkeit des gedruckten Wortes undenkbar gewesen.
Wenn es denn stimmt, dass die gegenwärtig zu beobachtenden Gesellschaftsumbrüche zur Informations- und Wissensgesellschaft mit denen bei der Erfindung des Buchdrucks vergleichbar sind - und davon ist ja oft genug die Rede - so lassen sich diese vermutlich auch erst im Nachhinein beschreiben.
In dem kurzen Auszug aus diesem Gespräch, das im übrigen nicht der fünf Jahrhunderte Unterschied der Gesprächspartner bedarf um so oder zumindest in ähnlicher Form überall stattfinden zu können, werden jedoch zentrale Punkte der gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskussion um die Zukunft der Informations- und Wissensgesellschaft und deren Risiken angesprochen.
- Erster Punkt: In einer Gesellschaftsformation, die die Termini Information und Wissen schon im Namen trägt, kommt dem Zugang zu Informationen und Wissen und dem Umgang damit grundlegende Bedeutung zu. Die elektronische Flut, die alles Gewesene hinwegspült, wird von den einen herbeigesehnt, von den anderen befürchtet. Euphorischen Erwartungen bis hin zu einem beinahe religiösen Glauben an die Überlegenheit neuer Technologien stehen berechtigte aber auch überzogene Ängste und Befürchtungen gegenüber. Man muss - wie immer im Leben - differenzieren: So wenig wie das Buch und die Verlage verschwinden werden, was nicht heisst, dass ihnen nicht neue und weitere Aufgaben zuwachsen werden, so wenig wird sich die Zugangsfrage von allen oder ausschliesslich nach Marktgesichtspunkten regeln lassen.
- Und schließlich zweiter Punkt, der auf diesem Symposium ja im Mittelpunkt steht und von daher ausführlicher zu betrachten sein wird: die Veredlung von Informationen und die Transformation in Wissen. Hier wird zu fragen sein, ob und inwiefern bestehende Strukturen und bewährte Instrumente ausreichen werden, diesem Wandel erfolgreich zu bestehen.
Damit ist schließlich auch der Rahmen dieses Referates abgesteckt.
Zugang zu und Umgang mit Informationen:
Die Sicherstellung des Zugangs zu wichtigen Informationen dürfte eine der zentralsten und angesichts ihrer fundamentalen Bedeutung zugleich eine der vornehmsten Aufgaben der Politik in den nächsten Jahren sein. Lange ist es her - es war im Jahre 1790 - dass der Bremer Rat offiziell die Lesewut der Bremer Bürgerschaft prüfte, weil Kritiker die Lesesucht der Bürger als Quelle kultureller Verflachung, Verdummung und Verrohung anprangerten. Der Bremer Rat konnte im übrigen keinen nachteiligen Eindruck auf Charakter und Denkungsart entdecken(2). Ganz im Gegenteil: Die Folgen des Buchdrucks für die Entwicklung offener und moderner Gesellschaften wurden ja Eingangs benannt. Wenn die gegenwärtigen Umbrüche nun vergleichbar sein werden, gilt es den Zugang aller zu allen wichtigen Informationen sicherzustellen.
Unterscheiden lassen sich drei Problemfelder bei den Fragen des Zugangs:
I. Zugangsprobleme bei Übertragungswegen:
- alte Monopole und neue Oligopole in der Telekommunikationsbranche,
- diskriminierender - weil bestimmte Nutzungsformen ausschließender - Zugang aufgrund herstellerspezifischer (proprietärer) Standards (z.B. Set-Top- oder 'Draufsetz'-Box),
- zu langsamer (Bandbreite) und zu teurer Zugang zum Internet
- zu nennen ist in diesem Zusammenhang auch der diskriminierungsfreie Zugang zur elektronischen Post (eMail), vor allem wenn man bedenkt, daß diese Kommunikationsmöglichkeit schon heute eine ähnliche Bedeutung hat wie das Telephon.
II. Zugangsprobleme bei der Produktion von Kommunikationsinhalten:
- Konzentrationsprozesse im Bereich der "traditionellen" wie auch der neuen Medien (Stichwort BertelKirch, Telekom/Kirch) - Stichworte sind hier Monopolbildung in Presse, Rundfunk und Fernsehen, digitales Fernsehen und 'Bezahlfernsehen, aber auch z.B. bei Online-Diensten (z.B. CompuServe und AOL, AOL und Time Warner),
- Konzentrationsprozesse bei neuen Inhalteanbietern, z.B. bei Datenbankherstellern
- die notwendige Weiterentwicklung diskriminierungsfreier Suchmechanismen und Orientierungsinformationen, um mit der immensen Informations- und Datenfülle überhaupt umgehen zu können,
- in diesem Zusammenhang sind auch die - in einigen Bereichen sicher wünschenswerten - Entwicklungen von Filter- und Bewertungssystem zu sehen, die auch dazu verwendet werden können, beispielsweise politisch 'unbequeme' Inhalte herauszufiltern.
III. Zugangsprobleme für den Nutzer/Rezipienten und Probleme beim Umgang:
- Zugang zu Informationen in einer Gesellschaft, in der wichtige Informationen zunehmend und oft ausschließlich in elektronischer Form vorliegen muß zu einer Neudefinition eines Public Service (Universaldienst) führen - definiert werden müssen, auch im Zusammenhang mit dem Grundversorgungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Informationen, die von öffentlichem Interesse sind, (was - ganz nebenbei, weit über die freie und unverschlüsselte Übertragung von Fußballspielen hinausgeht),
- Befähigung der Bürger und Bürgerinnen zu einem selbstbestimmten und verantwortungsvollen Umgang mit den neuen, differenzierteren Kommunikationsmöglichkeiten (Stichwort: Medienkompetenz),
- hierzu zählt auch die Kontrolle über Kommunikationsabläufe, um die Entfaltung einer freien und selbstbestimmten Kommunikation auch in den Datennetzen erst zu ermöglichen - Grundvoraussetzung ist hier die Ermöglichung und Befähigung der Menschen zum Selbstschutz und der - staatlich nicht eingeschränkte - Zugang zu diesen Selbstschutzinstrumenten (z.B. Signatur/Verschlüsselung).
Wissenschaftliche Information und Kommunikation
Kaum ein Bereich gesellschaftlicher Kommunikation ist - zwangsläufig - so sehr vom gegenwärtigen Wandel zur Informations- und Wissensgesellschaft betroffen, wie die wissenschaftliche Information und Kommunikation. Da dieses Symposium nun explizit der "Wissenschaftspublizistik" gewidmet ist, möchte ich diesem Bereich ein paar ausführlichere Ausführungen widmen, zumal ich - wie Sie sicherlich wissen - mit einem auf meine Initiative zustande gekommenen Arbeitskreis "Fachinformation und Fachkommunikatuion" hierzu auch einige grundlegende Eckpunkte vorgelegt habe, die Sie auf meiner Homepage unter www.tauss.de auch abrufen können.
Die technologische Innovationen bringen Veränderungen der kommunikativen Grundlagen in ihrer Gesamtheit mit sich, insbesondere hinsichtlich des Aktualitäts- wie Interaktivitätsgrades, der traditionellen Informations- und Publikationsketten sowie der Nutzer- und Nutzungsstrukturen. Neben den Herausforderungen durch neue Technologien kommen noch weitere gesellschaftliche Umbrüche hinzu, wie sie mit den Schlagworten Europäisierung und Globalisierung nur unzureichend zu fassen sind. Für die wissenschaftliche Fachinformation und -kommunikation erwachsen hieraus weitreichende Konsequenzen, die durch überkommene strukturelle Schwächen verstärkt werden:
- Bestehende strukturelle Schwächen: Die seit Jahrzehnten fehlende Kontinuität der (Fach-) Informations- und Kommunikationspolitik und die zum Teil gravierenden Konsequenzen bereits getroffener politischer Entscheidungen - ich erinnere nur an die m.E. vorschnelle Privatisierung von Datenbanken - hatten zur Folge, daß selbst eine noch so aufwendige staatliche Förderung nur eine begrenzte Wirkung erzielen konnte und im Zusammenhang mit konzeptionslosen und teilweise vorschnellen Privatisierungsvorhaben als Ergebnis eine zersplitterte und unübersichtliche Fachinformationslandschaft hinterließ.
- Technik: Die durch die Entwicklungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie erzeugten neuen Möglichkeiten verändern auch die Strukturen der Fachinformation und -kommunikation. Die durch eine umfassende Digitalisierung erst ermöglichte nahezu "medienbruchlose" wechselseitige Überführung von Texten, Tönen und Bildern ist sowohl die Voraussetzung für die Inter- bzw. Multimedialität als auch die treibende Kraft der weltweiten Vernetzung. Noch wichtiger aber ist die in Echtzeit mögliche weltweite wissenschaftliche Kommunikation, die Verknüpfung verschiedener Quellen (Hyperlinks) und die qualitativ neuartigen Suchroutinen und Recherchemöglichkeiten bis hin zu intelligenten Suchmaschinen (Informations- und Kommunikationsagenten etc.).
- Nutzer- und Nutzungsstrukturen: Analog zur beobachtbaren Erweiterung und Diversifikation der Nachfrageseite hat sich die Bandbreite, Spezifizität und schiere Menge - erinnert sei an die vielzitierte "Informations-Flut" - der zur Bewältigung des privaten und professionellen Alltags notwendigen Informationen und des Wissens vergrößert. Ein effektives Informationsmanagement erfordert unter den neuen Bedingungen der überbordenden Komplexität bei zunehmender Zeitknappheit insbesondere drei Punkte: neben der allgemeinen Verfügbarkeit, der entsprechenden nachfrageorientierten Aufbereitung vor allem auch die Auffindbarkeit innerhalb eines vertretbaren Zeitrahmens. Das überschaubare und konsistente Fachpublikum als Zielgruppe klassischer Fachinformationsangebote existiert in dieser Form nicht mehr, vielmehr entsteht eine sich ständig verändernde Nachfrageschnittmenge seitens professioneller und privater Nutzer.
- Anbieterstrukturen: Auch die Strukturen der Anbieterseite heutiger Informationsressourcen unterliegen einem grundlegenden Wandel: Sowohl die Anzahl als auch die Formen der als Anbieter auftretenden Institutionen nehmen ständig zu, die bisherigen institutionellen Absicherungen (Bibliotheken, Verlage, FIZe, etc.) unterliegen einem hohen Anpassungsdruck. Die Möglichkeit, mit einem vergleichsweise geringen Aufwand eine große Publizität zu erreichen, stellt die traditionellen Verlags-, Vertriebs- und Recherchestrukturen in Frage. Hinzu kommt - anders als ursprünglich erwartbar war - die Herausbildung eines (globalen) Wachstumsmarktes für Fachinformation, wobei zeitgleich die Aufspaltung in lukrative und weniger gewinnbringende - und hier ist zu befürchten: aus ökonomischer Perspektive zu vernachlässigende - Bereiche zu beobachten ist.
- Informations- und Publikationskette (Produzent-Mittler-Nutzer): Die Art und Weise wissenschaftlicher Publikationen, also die Qualitätssicherung, die Drucklegung sowie die Distribution, deren Verfügbarkeit (beispielsweise durch die Vorhaltung in Bibliotheken) und die bisherigen Instrumente der Recherche (Abfrage, Datenbanken), können diesen Wandel nicht ohne Folgen überstehen. Als Mittlerleistungen sind die Leistungen der wissenschaftlichen Information und Kommunikation von den gegenwärtigen Transformationen - beispielsweise durch das Internet - besonders betroffen. Das "Umschmieden der Publikationskette (Leskien) ist nicht gleichbedeutend mit der bloßen Herauslösung einzelner Kettenglieder, vielmehr geht es um eine funktionale Erweiterung bzw. Neubestimmung des Aufgabenkatalogs. Dies wird schon allein daraus ersichtlich, daß die strengen Anforderungen an wissenschaftliche Publikationen angesichts der immensen Zunahme des Informationsangebotes eher bestätigt als untergraben werden. Um es ganz klar zu sagen: Das bedeutet nicht, dass die Veredlung von Informationen beispielsweise durch Verlage überflüssig wird, im Gegenteil. Die Gatekeeper-Funktion wird im Sinne der Qualitätssicherung zunehmen: Die Qualitätssicherung - beispielsweise durch die Übertragung bzw. die Weiterentwicklung "traditioneller" Begutachtungs- und Review-Verfahren - muß auch in Zukunft gewährleistet bleiben.
- Bewahrung der Schutzrechte: Mit der Digitalisierung gibt es nicht mehr nur ein Original. Die Möglichkeiten der Vervielfältigung und die kaum festzustellenden nachträglichen Veränderbarkeit (Manipulation von Daten) erzwingen besondere technische und organisatorische Vorkehrungen zur Wahrung von bestehenden wie auch weiter zu entwickelnden Schutzrechten, z.B. die Wahrung der Urheberrechte der Autoren als auch die Wahrung der Integrität und Authentizität der Dokumente (digitale Wasserzeichen, digitale Signaturen, etc.). Vor gänzlich neuen Herausforderungen werden diese Schutzrechte durch die neuen Möglichkeiten des Netzwerk-Publizierens und des zeitoffenen Fortschreibens wissenschaftlicher Publikationen gestellt.
- Gedächtnis der Gesellschaft: In der gegenwärtigen Debatte um die Zukunft der Informations- und Wissensgesellschaft in ihrer Bedeutung noch gänzlich unterschätzt wird die Frage der langfristigen Speicher- und Archivierbarkeit. Wenn Information und Wissen zunehmend und oft ausschließlich in flüchtiger digitaler Form vorliegen, müssen hierfür Instrumente entwickelt werden, die das kulturelle Gedächtnis der Gesellschaft und die Kontinuität des Wissens sicherstellen (technische und inhaltliche Verfügbarkeit).
- Internationalisierung: Die in allen gesellschaftlichen Bereichen fortschreitende Europäisierung und Globalisierung hat gerade für die Fachinformation und -kommunikation - allein schon aufgrund des Wettbewerbsdrucks im Forschungsbereich - weitreichende Konsequenzen. Eine isolierte deutsche Fachinformationslandschaft, die seit den siebziger Jahren politisch erwünscht und erfolgreich aufgebaut wurde, stößt zunehmend an ihre Grenzen. Gegenwärtig ist vielmehr die Herausbildung internationaler Fachinformations- und Fachkommunikationsnetzwerke zu beobachten. Damit bleibt zu fragen, welche Bedeutung dem deutschen Fachinformationsangebot im weltweiten Wettbewerb zukommen kann und welche Gestaltungsmöglichkeiten einer lediglich national ausgerichteten Fachinformationspolitik letztlich verbleiben. Zu erkennen sind vor allem die Gefahren einer national nicht mehr umfassend zu gewährleistenden Leistungserbringung transnationaler Fachinformationsanbieter sowie die zunehmende Tendenz zur Monopolbildung in diesem Bereich.
All diese Faktoren bestätigen die Einschätzung, daß die bestehende Fachinformations- und Fachkommunikationslandschaft in ihrer derzeitigen Verfassung nicht in der Lage sein wird, auf diese fundamentalen Herausforderungen angemessene Antworten zu finden - und dies auch nicht sein kann. Vielmehr verdeutlichen sie die Notwendigkeit, daß der Staat seine Verpflichtung hinsichtlich der Gewährleistungspflicht ernst nehmen muß. Es ist und bleibt eine originär politische Aufgabe, gestaltend die Rahmenbedingungen auch für die wissenschaftliche Informationspolitik zu entwickeln und vorzugeben.
In einer Situation des grundlegenden Umbruchs ist die Wahl der eingesetzten Mittel sorgfältig abzuwägen. So stellt sich beispielsweise die Frage, ob und inwieweit die sich entfaltenden Marktkräfte allein der staatlichen Gewährleistungsverpflichtung bereits genügen können, oder ob die Bedeutung des Fachinformationsangebotes als eine primär öffentliche Aufgabe angesehen werden sollte bzw. das Marktversagen in bestimmten Bereichen staatliches Handeln geradezu erzwingt.
Schluß:
Lassen Sie mich am Schluß noch einmal auf das eingangs erwähnte Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse zurückkommen: Gutenberg beendet das Gespräch, bevor Gates - wie der Berichterstatter Updike beobachtet - mit einem Zischen in sich zusammensinkt, mit der Feststellung: "Ihr sprecht von diesem weltumspannenden Internet, als reichte es über das menschliche Gehirn hinaus. Aber der Mensch ist noch immer das Maß aller Dinge." Damit das so bleibt, gilt es, die Herausforderung der Technik anzunehmen, gesellschaftliche Visionen und Leitbilder zu formulieren und Gestaltungskonzepte zu entwickeln, um so der Reise eine Richtung geben zu können. Daher möchte ich meine Ausführungen schließen mit einem Gruß, den man im Internet immer häufiger antrifft - der zwar die vielen berechtigten Ängste und Unsicherheiten nicht aufhebt, aber für das hier angesprochene Thema Anlaß zur Hoffnung gibt: "Man liest sich!". Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
1:
John Updike: Das Maß aller Dinge. Bill Gates im Gespräch mit Johannes Guten-berg. In: Spiegel special. Die Multimedia-Zukunft. 3/1996: 156-159. Übersicht
2:
Vgl. Schmidt, Siegfried J.: Der Umgang mit "Informationen", oder: Das Nadelöhr Kognition. In: Tauss, Jörg/Kollbeck, Johannes/Mönikes, Jan: Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft. Herausforderungen und Perspektiven für Wirtschaft, Wissenschaft, Recht und Politik. Baden-Baden. 1996: 183. Übersicht
[Hauptseite]
[Zur Person]
[Wahlkreis]
[Bundestag]
[Kontakt]
[Links]